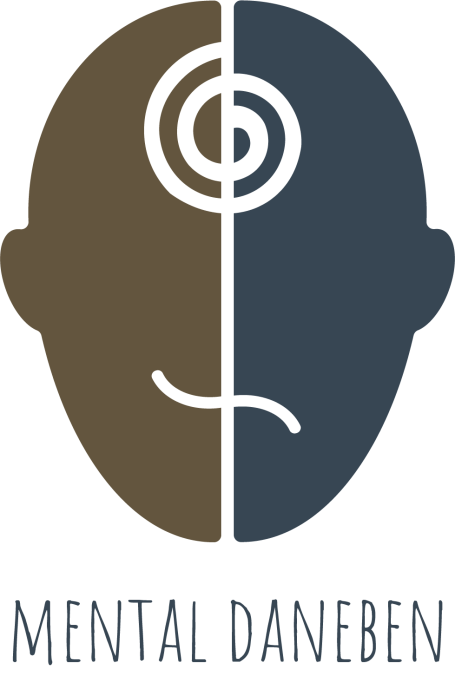Frau Beatrice Wolff-Bigler ist Abteilungsleitende für Integrationsmassnahmen und Coaching in der BEWO, Berufliche Eingliederung in Oberburg und wie sie selbst sagt "gleichzeitig Feuerwehrfrau (lösche Konflikte), Jongleurin (balanciere Pläne, Teams, Exceltabellen, Krankmeldungen und Budgets) und Psychiaterin wider Willen für die Kaffeemaschine, die auch mal zusammenbricht."
Mit diesem sehr persönlichen Beitrag gewährt uns Frau Wolff einen direkten Einblick in ihren aussergewöhnlichen Arbeitsalltag.

Frau Wolff, was genau ist Ihre Aufgabe als fallführende Person bei der BEWO?
Meine Funktion ist Abteilungsleitende der Integrationsmassnahmen und Coachings. Zu meinen Aufgaben gehören u.a.:
Führen der Abteilung und Personal
- Vertreten der Institution gegenüber der IV
- Redigieren von Berichten an die IV-Stelle
- Verantwortlich für die Qualitäts- und Terminerfüllung bei den Massnahmen
- Verantwortlich, dass die Arbeitsplätze hindernisfrei eingerichtet sind
- Unterstützen des Teams bei Krisensituationen
- Budget- und Investitionsplanung
Integrationsmassnahmen / Coachings
- Führen von Vorstellungs-, Eintritts-, Standort- und Schlussgesprächen bei Integrationsmassnahmen
- Verfassen von Aktennotizen
- Führen und fördern der Kunden entsprechend der Zielvereinbarung
- Befähigen der Kunden, um die gesteckten Ziele zu erreichen und mögliches Entwicklungspotential zu eruieren
- Enge Zusammenarbeit mit der Werkstatt Integrationsmassnahmen, sowie abteilungsübergreifende Zusammenarbeit mit dem Stammbetrieb
- Regelmässiger Austausch mit den Case Managern der IV
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Therapeuten / Ärzten / Ämtern
- Planen und organisieren von betriebsinternen Einsätzen
- Je nach Ressourcen der Kunden, planen und organisieren von Einsätzen im ersten
- Arbeitsmarkt
- Erstellen von Schlussberichten zu Handen der IV und anderen Sozialversicherungen
- Unterstützen der Klientinnen / Klienten beim Stellenbewerbungsprozess
- Akquirieren von Arbeitgebern / Einsatzplätzen
- Begleiten und unterstützen der Arbeitgeber
- Kriseninterventionen
Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag für Sie aus?
Es gibt keinen typischen Arbeitsalltag. Er ist jedoch immer dynamisch und abwechslungsreich. Öfters trage ich pro Tag mehrere Hüte, führe Gespräche mit unseren Kunden, Sozialversicherungen, Arbeitgebern, Ärzten, Psychologen oder anderen Bezugspersonen. Ein wesentlicher Anteil ist das Verfassen von Verlaufsprotokollen und Berichten als Rückmeldung für zuweisende Stellen.
Was hat Sie persönlich motiviert, in diesem Bereich zu arbeiten?
MMMM: Man muss Menschen mögen. Im beruflichen und privaten Umfeld habe ich erlebt, wie schnell Aussenfaktoren dazu beitragen, dass man das innere Gleichgewicht verliert. Hierzu einen Beitrag zu leisten, Menschen zu befähigen, Chancen zu erkennen und anzunehmen hat mich motiviert.
Welche Herausforderungen erleben Sie bei der beruflichen Integration von Menschen mit psychischen Erkrankungen?
Insgesamt geht es häufig darum, ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen des Arbeitsplatzes und den individuellen Möglichkeiten der Betroffenen zu schaffen, und gleichzeitig ein offenes, inklusives Betriebsklima zu fördern.
Die berufliche Integration von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist für viele Betriebe und Institutionen mit spezifischen Herausforderungen verbunden. Typische Aspekte, die dabei häufig genannt werden, sind:
Stigmatisierung und Vorurteile
Häufig bestehen in der Arbeitswelt immer noch Berührungsängste, Unsicherheiten oder Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen. Betroffene erleben teilweise Diskriminierung oder Ausgrenzung.
Unsichtbarkeit und Schwankung der Erkrankung
Psychische Erkrankungen sind nicht unmittelbar erkennbar und können sich in sehr unterschiedlichen Symptomen äussern. Krankheitsverläufe sind oft von Schwankungen geprägt, sodass Stabilität im Arbeitsalltag schwer vorhersehbar sein kann.
Belastbarkeit und Leistungsanforderungen
Viele Arbeitsplätze sind durch hohen Leistungsdruck, enge Zeitvorgaben oder wechselnde Anforderungen gekennzeichnet. Menschen mit psychischen Erkrankungen brauchen häufig mehr Flexibilität, was Arbeitszeit, Aufgaben oder Pausen angeht.
Offener umgang mit der Erkrankung
Betroffene stehen oft vor dem Dilemma, ob sie ihre Erkrankung offenlegen sollen oder nicht. Arbeitgeber und Kolleg:innen wissen nicht immer, wie sie damit sensibel und konstruktiv umgehen können.
Unterstützung und Anpassungsbedarf im Betrieb
Es fehlt teilweise an Wissen, wie Arbeitsplätze gestaltet oder angepasst werden können (z. B. flexible Arbeitszeitmodelle, klare Strukturen, geschützte Räume). Auch Führungskräfte fühlen sich oft nicht ausreichend geschult, um auf die besonderen Bedürfnisse einzugehen.
Schnittstellenproblematik
Die Zusammenarbeit zwischen medizinischen/therapeutischen Angeboten, Reha-Trägern, Sozialversicherungen, Integrationsprogrammen und Arbeitgebern ist nicht immer reibungslos. Fehlende Kontinuität in der Betreuung erschwert den Integrationsprozess.
Welche psychischen Diagnosen treten am häufigsten auf?
Burnout und Mobbingerfahrungen über Jahre, wobei Letzteres nicht ausschliesslich bei der Arbeit auftritt, sondern auch im privaten Umfeld stattfinden und zu einer ängstlich – vermeidenden Haltung führen kann.
Warum ist Arbeit für viele Betroffene ein wichtiger Teil der Genesung?
Arbeit hat für Menschen mit psychischen Erkrankungen eine grosse Bedeutung, weil sie weit mehr ist als nur „Erwerbseinkommen“. Sie erfüllt zentrale soziale und psychologische Funktionen.
Kurz gesagt: Arbeit bedeutet für Menschen mit psychischen Erkrankungen mehr Teilhabe, Stabilität und Selbstwert – und ist damit ein zentraler Baustein der sozialen und gesundheitlichen Rehabilitation.
Struktur und Alltag
Arbeit gibt dem Tag einen festen Rhythmus und schafft Orientierung. Sie fördert Verlässlichkeit und Stabilität, was für die Krankheitsbewältigung wichtig sein kann.
Soziale Teilhabe
Arbeit ermöglicht Kontakte zu Kolleg:innen und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Sie beugt sozialer Isolation vor, die bei psychischen Erkrankungen oft ein Risiko ist.
Sinn und Selbstwertgefühl
vermittelt das Gefühl, gebraucht zu werden und etwas Sinnvolles beizutragen. Sie stärkt Selbstbewusstsein und Identität.
Finanzille unabhängigkeit
Eigener Verdienst sichert Lebensunterhalt und reduziert Abhängigkeit von Sozialleistungen.
Das wirkt sich positiv auf das Selbstbild und die gesellschaftliche Teilhabe aus.
Gesundung und Stabilisierung
Teilhabe am Arbeitsleben kann Teil eines therapeutischen Prozesses sein. Arbeit kann das Wohlbefinden fördern und Rückfälle vorbeugen – sofern die Rahmenbedingungen passend sind.
Die Rückkehr in den arbeitsalltag
Die BEWO unterstützt betroffene Personen auf vielfältige Weise dabei, im Arbeitsmarkt wieder Fuss zu fassen. Doch es geht um weit mehr, als nur einen neuen „Job“ zu finden. Im Zentrum steht eine individuelle und sorgfältige Planung, die den Menschen in seiner Gesamtheit betrachtet. So entsteht eine realistische Perspektive, die dabei hilft, langfristig im ersten Arbeitsmarkt bestehen zu können – und nicht nur kurzfristig anzukommen.
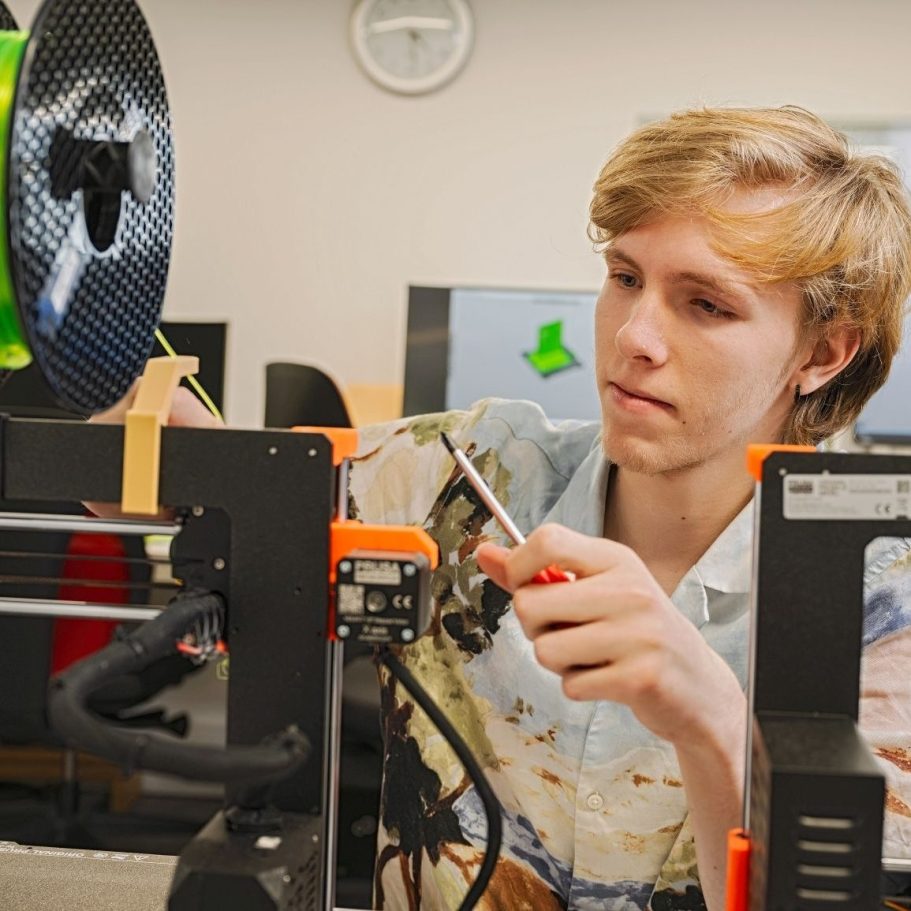
Vorbereitung
- individuelle Belastungs- und Fähigkeitenbilanz
- realistische Ziel- und Zeitplanvereinbarung (Schritt-für-Schritt)
- Kommunikation und Kooperation
- Abstimmung mit Arbeitgeber, Fach- und Bezugspersonen
- klare, vertrauliche Kommunikationswege
- flexible Arbeitszeiten, Teilzeit oder schrittweise Wiedereingliederung
- ruhige Arbeitsumgebung, klare Aufgaben, überschaubare Verantwortlichkeiten
- regelmässige Pausen, Rückzugsmöglichkeiten

Massnahmen
- Coaching, Einzeltherapie oder Enkounterstützung
- Supervision, Mentoring oder kollegiale Unterstützung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement, EAP, ggf. Gesundheits- oder Rechtsberatung
- Kompetenzen stärken

Persönlich
- soziale Fertigkeiten, Konfliktlösung in Frequenz- und Feedbackgesprächen
- Motivation und Selbstwirksamkeit stärken
- Begleitende Begutachtung
- regelmässige Fortschrittskontrollen (z. B. alle 4–6 Wochen)
- Anpassungen bei Bedarf (Aufgabenumfang, Ressourcen)
- Umgang mit Rückschlägen
- Frühwarnzeichen erkennen, Plan anpassen statt ändern der Grundintention
- Ermutigung zu offener Kommunikation bei Belastung
- Dokumentation und Datenschutz
- vertrauliche Dokumentation über Fortschritte, datenschutzkonforme Weitergabe nur mit Einwilligung
Welche Rolle spielen Arbeitgeber dabei? Gibt es Vorbehalte?
Arbeitgeber spielen eine zentrale Rolle bei der beruflichen Integration von Menschen mit psychischen Belastungen.
Was kann ein Arbeitgeber unter anderem tun?
- Arbeitsplatzgestaltung: flexible Arbeitszeiten, klare Erwartungen, ruhige, reizarme Arbeitsumgebung, ausreichend konstruktives Feedback
- Anpassungen am Arbeitsplatz: Barrierefreiheit, Rückzugsmöglichkeiten, lichtdurchflutete Räume, ergonomischer Arbeitsplatz
- Support und Ressourcen: betriebliches Gesundheitsmanagement, Supervision oder Mentoring.
- Transparente Kommunikation: klare Rollenbeschreibung, regelmässige Feedbackgespräche, Schritt-für-Schritt-Einführung neuer Aufgaben
- Schulung und Sensibilisierung: Sensibilisierung von Teams, Umgang mit Angst- und sozialen Hemmungen, Förderung einer inklusiven Betriebskultur
- Karrierewege: realistische Ziele, Weiterbildungsangebote, Förderung von Stärken statt Schwächen
- Rechtlicher Rahmen: Einhaltung von Gleichbehandlung, Diskriminierungsverbot, Datenschutz und Schweigepflicht
Vorbehalte, die auftreten können
- Angst vor Leistungsausfällen oder Inkonsistenz bei Arbeitsleistung
- Befürchtung, dass Sozialverhalten problematisch sein könnte (z. B. Zurückhaltung, Konfliktpotential)
- Sorge vor erhöhtem Betreuungs- und Kostenaufwand (Schulungen, Anpassungen)
- Unsicherheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen, Fehlurteile oder Stigmatisierung.
- Fehlende Zeitressourcen für individuelle Einarbeitung
- Bedenken, dass lange Einarbeitungsphasen die Teamdynamik belasten
Was hilfreich sein kann
- Frühzeitige, offene Kommunikation über Bedürfnisse unter Einhaltung von Datenschutz und Schweigepflicht
- Zusammenarbeit mit Betriebsärzten, Arbeitspsychologen oder externen Coaches
- Klare, erreichbare Ziele und regelmäßiges Feedback
- Pilotphase mit flexibler Anpassung; schrittweises Hochfahren der Verantwortung
- Positive Beispiele aus dem Unternehmen, um Vorurteile abzubauen.
- Arbeitgeber sollten individuelle Unterschiede anerkennen; es gibt keine „Einheitslösung“.
- Unterstützung durch das Arbeitsumfeld ist oft wirksamer als isolierte Massnahmen.
- Kooperation mit dem Betroffenen, ggf. mit medizinischer oder therapeutischer Begleitung, verbessert die Erfolgsquote.
Wie sieht eine gelungene Zusammenarbeit mit Ärzt:innen, Therapeut:innen oder Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen aus?
- Offene und respektvolle Kommunikation: Informationen werden transparent geteilt (unter Wahrung der Schweigepflicht)
- Klare Absprachen und Zuständigkeiten: Jeder weiss, welche Rolle er übernimmt (z. B. medizinische Versorgung, therapeutische Begleitung, Unterstützung im Alltag oder Beruf)
- Regelmässiger Austausch: Rückmeldungen über Fortschritte oder Schwierigkeiten helfen, Massnahmen anzupassen
- Einbeziehung der Angehörigen: Wenn gewünscht, werden sie als Ressource gesehen und erhalten Unterstützung im Umgang mit Belastungen.
- Individuelle Ausrichtung: Die Massnahmen werden auf die persönlichen Bedürfnisse, Ressourcen und Ziele der Betroffenen abgestimmt
- Wertschätzung: Alle Beteiligten arbeiten auf Augenhöhe – die Meinung der Betroffenen selbst steht dabei im Zentrum
Eine gelungene Zusammenarbeit gelingt, wenn Ärzt:innen, Therapeut:innen und Angehörige offen kommunizieren, klare Absprachen treffen und gemeinsam die Bedürfnisse der betroffenen Person in den Mittelpunkt stellen. Wichtig ist ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe und die Einbindung der Angehörigen als unterstützende Ressource.
Was hat Sie in Ihrer Arbeit besonders berührt oder beeindruckt?
- Die Stärke und der Mut vieler Betroffener, trotz Rückschlägen immer wieder aufzustehen und weiterzumachen.
- Die Offenheit und das Vertrauen, wenn jemand seine Geschichte teilt und dich in seine Lebenswelt blicken lässt.
- Kleine Fortschritte, die für Aussenstehende unscheinbar wirken, für Betroffene aber ein grosser Erfolg sind (z. B. wieder Bus fahren, erste Arbeitsstunden schaffen, sich einer Gruppe anschliessen).
- Die Menschlichkeit, die spürbar wird, wenn man die Person hinter der Erkrankung sieht – mit ihren Talenten, ihrem Humor und ihren Träumen.
- Die Dankbarkeit, die Betroffene zeigen, wenn sie sich verstanden und unterstützt fühlen.
Besonders berührt hat mich, wie viel Mut und Durchhaltevermögen Menschen mit psychischen Erkrankungen aufbringen, um trotz vieler Schwierigkeiten ihren Alltag zu meistern. Beeindruckt hat mich, wie wichtig kleine Schritte sein können und wie viel Kraft und Dankbarkeit in solchen Momenten spürbar wird.
Gibt es ein Beispiel, das zeigt, wie wichtig individuelle Begleitung ist?
Eine junge Frau mit einer Angststörung hat nach längerer Krankheit eine Arbeitsstelle im Büro gefunden.
- Ohne individuelle Begleitung: Sie wird sofort voll in die Abläufe integriert, fühlt sich überfordert, ihre Ängste nehmen zu und nach kurzer Zeit bricht sie die Stelle wieder ab.
- Mit individueller Begleitung: Gemeinsam mit einem Integrationcoach wird ein Stufenplan erarbeitet. Zunächst beginnt sie mit wenigen Stunden, erhält klare Aufgaben und einen festen Ansprechpartner im Betrieb. Schrittweise wird das Pensum erhöht. Durch diese passgenaue Unterstützung stabilisiert sie sich, gewinnt Selbstvertrauen und kann dauerhaft im Betrieb arbeiten.
Individuelle Begleitung sorgt dafür, dass nicht nur die Diagnose, sondern der Mensch mit seinen persönlichen Bedürfnissen und Ressourcen im Mittelpunkt steht. So können Überforderung, Rückfälle und Abbrüche verhindert und langfristige Integration ermöglicht.
Welche ersten Schritte kann man gehen, wenn man wieder Teil des Arbeitslebens sein möchte?
Wichtig sind praktische und realistische Schritte. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist ein sanfter, gut begleiteter Einstieg entscheidend.
Erste Schritte können sein, die eigene Belastbarkeit gemeinsam mit Ärzt:innen oder Berater:innen einzuschätzen, eine stufenweise Wiedereingliederung zu planen und sich ggf. durch Praktika oder Integrationsmassnahmen vorsichtig an den Arbeitsalltag heranzutasten. Wichtig ist dabei, realistische Ziele zu setzen und den Prozess gut zu begleiten.
Selbstreflexion und Beratung
- Kontakt mit den Sozialversicherungen aufnehmen
- Eigene Belastbarkeit einschätzen: „Was traue ich mir aktuell zu?“
- Unterstützung durch Ärzt:innen, Therapeut:innen suchen
- Stufenweise Wiedereingliederung
- langsam mit wenigen Stunden starten und Schritt für Schritt steigern
Berufliche Orientierung
- Prüfen, ob der alte Arbeitsplatz (noch) passt oder ob eine neue Tätigkeit sinnvoll ist
- Beratung durch involvierte Fachstellen
- Praktika oder Arbeitserprobung
- In einem geschützten Rahmen Erfahrungen sammeln, ohne gleich voll einzusteigen
Aufbau von Stabilität
- Struktur im Alltag üben (z. B. feste Schlaf- und Essenszeiten)
- Strategien zur Stressbewältigung einplanen (Pausen, Entspannungstechniken)
Welche Hürden sollten dringend abgebaut werden?
Dringend abgebaut werden sollten vor allem Vorurteile und Stigmatisierungen, bürokratische Hürden beim Zugang zu Hilfen sowie Barrieren im Arbeitsleben. Wichtig ist, dass psychisch belastete Menschen leichter Unterstützung finden und in allen Lebensbereichen gleichberechtigt teilhaben können.
Was möchten Sie Betroffenen und deren Umfeld mit auf den Weg geben?
Ich möchte Betroffenen mitgeben, dass sie ihre Erkrankung nicht allein tragen müssen und dass es in Ordnung ist, Hilfe anzunehmen. Ihrem Umfeld möchte ich mit auf den Weg geben, geduldig, offen und unterstützend zu sein, um gemeinsam Wege zur Stabilität und Teilhabe zu finden.
Für Betroffene
- Trauen Sie sich, Hilfe anzunehmen – es ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche.
- Seien Sie geduldig mit sich selbst – Heilung und Stabilisierung brauchen Zeit.
- Sie sind mehr als Ihre Erkrankung – Ihre Fähigkeiten und Stärken bleiben bestehen.
Für Angehörige und Umfeld
- Hören Sie zu und nehmen Sie die Gefühle der Betroffenen ernst.
- Üben Sie Verständnis und Geduld, auch wenn es manchmal schwerfällt.
- Informieren Sie sich über die Erkrankung, um besser unterstützen zu können.